Zwei neue Studien bei akuter Herzinsuffizienz
Kommentar--
Veröffentlicht:
Prof. Dr. Stefan Frantz-- Uniklinik Würzburg Frantz
© Frantz
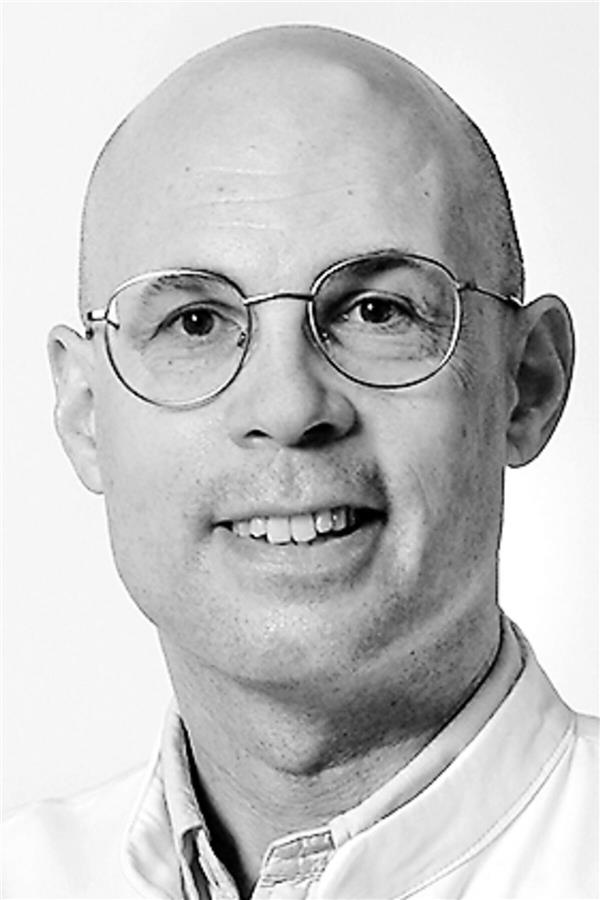
Prof. Dr. Philip Raake-- Uniklinik Augsburg Raake
© Raake
DICTATE-AHF-Studie
In der prospektiv randomisierten DICTATE-AHF-Studie wurde die Ergänzung von Dapagliflozin zur intravenösen Schleifendiuretikagabe bei Patienten mit akuter Herzinsuffizienz untersucht. Im Kontrollarm erfolgte die Standardtherapie. Es zeigte sich ein Trend zu einer gesteigerten diuretischen Effizienz in der Interventionsgruppe. Obwohl der primäre Endpunkt keine Signifikanz erreichte, war eine erhöhte diuretische Wirksamkeit ähnlich zu Empagliflozin in der EMPULSE-Studie zu beobachten. Die Strategie mit Ergänzung eines SGLT-2-Hemmers war sicher. Insgesamt kann also ein SGLT-2-Hemmer frühzeitig angesetzt werden, potenziell unterstützt der zusätzliche diuretische Effekt die Dekongestion.
PUSH-AHF-Studie
Die PUSH-AHF-Studie wurde als prospektiv randomisierte Studie konzipiert und untersuchte bei Patienten mit akuter Herzinsuffizienz eine personalisierte diuretische Strategie mit Messung der Natriurese im Urin. Bei inadäquater Natriurese erfolgte in der Interventionsgruppe die gezielte Steigerung der Therapie und ggf. Ergänzung von Hydrochlorothiazid oder in sehr wenigen Fällen Azetazolamid. In der Studie wurde als Schleifendiuretikum Bumetanid eingesetzt. Der Kontrollarm folgte dem üblichen Behandlungsstandard, ebenso mit Bumetanid als Schleifendiuretikum. Im dualen Endpunkt zeigte sich in der Interventionsgruppe eine Steigerung der Natriurese, im zweiten kombinierten Endpunkt Sterblichkeit und Herzinsuffizienz-Rehospitalisierung fand sich kein Unterschied. Allerdings war die Sterblichkeit im Krankenhaus in der Interventionsgruppe geringer. Eine personalisierte Strategie abgleitet von der Natriurese ist somit sicher, vermehrte Elektrolytentgleisungen oder ein stärkerer Anstieg der Nierenretentionswerte wurde nicht beobachtet. Eine weitere Studie zur Natriurese-geführten Therapie läuft in den USA, die Ergebnisse beider Studien sollen dann im Verlauf auch gemeinsam analysiert werden.
Erhöhter Aufwand bei marginalen Effekten
In der ESC-Herzinsuffizienz-Leitlinie von 2021 findet sich bereits eine entsprechende Empfehlung. Insgesamt ist die erhöhte Natriurese in der Behandlungsgruppe Ausdruck eines verstärkten Einsatzes von Thiaziden, also einer kombinierten Nephronblockade, wie es aus dem Studiendesign auch zu erwarten war. Der Aufwand für den einzelnen Patienten in der klinischen Routine ist höher, die Effekte marginal. Durch die gesteigerte Diurese war der Krankenhausaufenthalt nicht signifikant verkürzt. Ein direkter Vergleich mit klaren Gewichtsvorgaben zur Entwässerung als Kontrollgruppe, der Kombination eines Schleifendiuretikums mit Azetazolamid (ADVOR-Studie) und ein Vergleich mit der Kombination eines SGLT-2-Hemmers wären wünschenswert. Eine Veränderung des Standardvorgehens lässt sich hieraus momentan nicht ableiten.


