Eisen bei Herzschwäche: mehr Evidenz
HEART-FID-Studie-- Eine große Endpunktstudie zu i.v. Eisencarboxymaltose bei Herzinsuffizienz verfehlt ihr Studienziel. Eine Metaanalyse allerdings findet eine Reduktion bei Klinikeinweisungen. Kardiologen sehen in der Gesamtschau eine „robuste Evidenz“ für i.v. Eisen bei Herzinsuffizienz.
Veröffentlicht: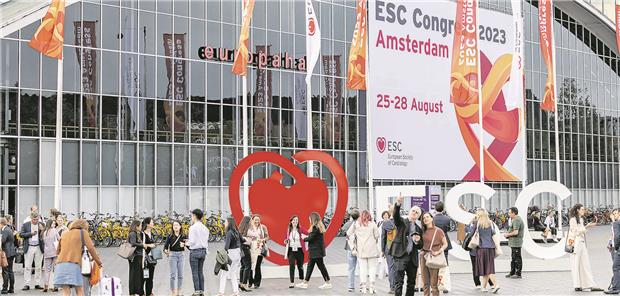
Mal schnell Luft schnappen zwischen den Vorträgen der insgesamt 9 Hot-Line-Sessions.
© ESC/Krisztian Juhasz
Randomisierte Studien zu i.v. Eisen bei der Herzinsuffizienz gibt es mehrere. In der Studie CONFIRM-HF wurde Eisencarboxymaltose (FCM) bei chronischer, in AFFIRM-AHF bei akuter Herzinsuffizienz untersucht. Die im vergangenen Jahr vorgestellte, nicht verblindete IRONMAN-Studie untersuchte i.v. Eisenderisomaltose bei Herzschwäche.
Komposit-Endpunkt verbessert?
Die Studien zeigten bisher, dass Patienten und Patientinnen mit Herzinsuffizienz und Eisenmangel hinsichtlich der Symptome und Lebensqualität profitieren, so Prof. Piotr Ponikowski von der Universität Warschau bei der ESC-Tagung in Amsterdam. Es sei aber weiterhin unklar, wie es mit Krankenhauseinweisungen und Sterblichkeit aussehe.
Die doppelblinde HEART-FID-Studie

Referent und Diskutant-- Robert Mentz und Scott Solomon bei der Präsentation der HEART-FID-Studie.
© ESC/Tobias Koch
Signifikanzniveau nicht ganz erreicht
Im Ergebnis zeigten sich in den Endpunktkomponenten Vorteile für die i.v. Eisengabe, aber das Studienziel wurde verfehlt. Der p-Wert in der statistischen Analyse habe 0,019 betragen, der mit den US-Behörden abgesprochene Signifikanzlevel lag aber bei 0,01. Konkret starben 10,3 % der Patienten in der Placebo-Gruppe und 8,6 % in der FCM-Gruppe. 14,8 % bzw. 13,3 % wurden wegen Herzinsuffizienz eingewiesen. Der 6-Minuten-Gehtest verbesserte sich im Mittel um 4 Meter (Placebo) bzw. 8 Meter (FCM). Beim sekundären Endpunkt gab es nach einem medianen Follow-up-Zeitraum von 1,9 Jahren zu 17,3 % (Placebo) bzw. 16,0 % (FCM) Ereignisse, auch das war nicht signifikant.
Metaanalyse sieht Vorteile
Ponikowski stellte in Amsterdam ergänzend eine neue Metaanalyse vor, die die FCM-Studien HEART-FID, CONFIRM und AFFIRM zusammenbringt. Diese findet in einem ihrer zwei präspezifizierten Endpunkte, „kardiovaskulärer Tod oder kardiovaskuläre Krankenhauseinweisung“, eine signifikante Reduktion um 14 % (HR 0,86; 95%-KI 0,75–0,98) durch FCM, getrieben durch die Klinikeinweisungen. Beim zweiten präspezifizierten Endpunkt, „kardiovaskulärer Tod oder herzinsuffizienzbedingte Krankenhauseinweisung“, gibt es eine nicht signifikante Reduktion um 13 %. Bei Mortalität als Einzelpunkt gibt es keine Unterschiede.
Muss die Eisenmangel-Definition geschärft werden?
In einer interessanten Nachanalyse zeigte sich, dass eine TSAT < 15 % deutlich prädiktiv für einen Nutzen von FCM war. Die Risikoreduktion für kardiovaskulären Tod oder Hospitalisierung betrug hier 28 %. „In ihrer Gesamtschau spricht die Evidenz für die Sicherheit und den klinischen Nutzen von FCM bei HFrEF mit Eisenmangel“, betonte Mentz. Es sei eine für die Patienten komfortable Therapie, die die Lebensqualität und die Belastbarkeit verbessere und per Metaanalyse belegt günstige Auswirkungen auf Klinikeinweisungen habe: „Wir nutzen das immer häufiger, es ist ein wichtiges therapeutisches Tool geworden“, so Mentz, der anregte, angesichts der TSAT-Daten über die Definition von Eisenmangel noch einmal nachzudenken.
Fazit
Eisenmangel ist bei Herzschwäche mit einer ungünstigen Prognose verbunden.
Eisensubstitution verbessert die Symptomatik bei Herzschwäche.
Die Datenlage zur Prognoseverbesserung einer Eisensubstitution bleibt heterogen.
Eventuell muss die Definition des Eisenmangels enger gefasst werden.
Quelle-- ESC-Kongress, Hot-Line-Session 2, 25. bis 28. August in Amsterdam
Literatur-- Mentz RJ et al. N Engl J Med. 2023; https://doi.org/10.1056/NEJMoa2304968

