VA-ECMO in Studie ohne Nutzen
Kardiogener Schock-- Nächste Studienenttäuschung beim kardiogenen Schock: Die immer beliebter werdende VA-ECMO kann in der ECLS-SHOCK-Studie die Sterblichkeit nicht reduzieren.
Veröffentlicht: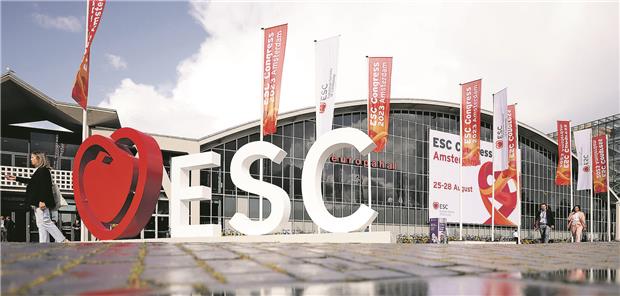
Patienten nicht im Regen stehen lassen: Beim ESC vorgestellte Studien tragen zur besseren Versorgung bei.
© ESC/Tobias Koch
Die Sterblichkeit beim kardiogenen Schock nach Infarkt liegt bei etwa 50 Prozent. Bessere Therapien sind verzweifelt gesucht, aber bisherige Studien verliefen oft erfolglos. Ein prominentes Beispiel war vor zehn Jahren die IABP-SHOCK-II-Studie, die keinen Nutzen der intraaortalen Ballonpumpe (IABP) fand, einer passiven mechanischen Kreislaufunterstützung. Mittlerweile erhalte die IABP in den ESC-Leitlinien nur noch eine Klasse-IIIB-Empfehlung, sagte Prof. Holger Thiele vom Herzzentrum Leipzig.
Abgelöst wurde die IABP nach der IABP-SHOCK-II-Pleite von aktiven Kreislaufunterstützungssystemen, darunter die VA-ECMO. „Bei der Anwendung der VA-ECMO gab es in den letzten zehn Jahren einen Anstieg um den Faktor zehn, ohne jede Evidenz“, so Thiele. Eine andere Form der Kreislaufunterstützung beim kardiogenen Schock, die ebenfalls populärer geworden ist, ist die perkutane Herzpumpe Impella, die auch mit der VA-ECMO kombiniert werden kann.
ECLS SHOCK Studie: Keine Subgruppe profitierte
Thiele stellte bei der ESC-Tagung in Amsterdam die Ergebnisse einer neuen großen Schockstudie aus Deutschland vor, der ECLS-SHOCK-Studie. Es ist die bisher größte, randomisierte Studie, die beim kardiogenen Schock nach Myokardinfarkt VA-ECMO mit konventioneller Versorgung verglichen hat. 420 Patienten nahmen teil. Primärer Endpunkt war die Gesamtmortalität nach 30 Tagen. Die Studiengröße wurde auf Basis einer postulierten Mortalität von 49 % in der Kontrollgruppe und einer postulierten Reduktion der Sterblichkeit um absolut 14 % in der VA-ECMO-Gruppe berechnet.
Thiele betonte, dass sich ECLS SHOCK bemüht habe, nicht zu viele Patienten auszuschließen. Insgesamt 877 Patienten wurden gescreent, es wurde also knapp jeder zweite inkludiert. Ein wichtiges Kriterium war ein arterielles Laktat > 3 mmol/l, was Patienten mit erhöhtem Risiko entspricht. Das Ergebnis der Studie sei enttäuschend, so Thiele. Im Kontrollarm starben die postulierten 49 % der Patienten. Im VA-ECMO-Arm waren es 47,8 %, statistisch kein Unterschied. Auch in den sekundären Endpunkten liefen die Gruppen praktisch identisch: „Laktat war in der VA-ECMO-Gruppe zu keinem Zeitpunkt besser als in der Kontrollgruppe, gleiches galt für die Nierenfunktion und den SAPS-II-Score“, so Thiele. Der SAP-II-Score ist ein Maß für den Umfang der intensivmedizinischen Versorgung. Es gebe auch keine Subgruppe, in der sich für die VA-ECMO ein Vorteil erkennen lasse. Wenn es sie gäbe, dann sei sie wahrscheinlich nicht größer als ein Prozent aller Patienten, so Thiele.
Mehr Komplikationen bei VA-ECMO- Therapie
Die Komplikationsrate war bei Einsatz der VA-ECMO höher. Moderate oder schwere Blutungen traten bei 23,4 % der Patienten auf, gegenüber 9,6 % in der Kontrollgruppe. Periphere ischämische Komplikationen mit interventionellem oder chirurgischem Therapiebedarf gab es bei 11,0 %, gegenüber 3,8 % in der Kontrollgruppe. So gesehen war die ECLS-SHOCK-Studie, die parallel im New England Journal publiziert wurde, keine neutrale, sondern eine negative Studie. Thiele stellte auch gleich noch eine von Prof. Uwe Zeymer, Klinikum Ludwigshafen, federführend betreute Metaanalyse auf Basis individueller Patientendaten vor, die parallel im Lancet publiziert wurde. Sie umfasst noch die drei kleineren Studien ECLS SHOCK I, ECMO-CS und EURO-SHOCK. Auch in dieser Gesamtschau gibt es weder einen Hinweis auf Mortalitätssenkung noch auf Subgruppen, die profitieren würden.
Thiele tat sich in Amsterdam hörbar schwer bei der Frage, wie es jetzt auf den kardiologischen Intensivstationen weitergehen sollte. Es spreche einiges für „weniger ist mehr“, so der Kardiologe. Er wies darauf hin, dass eine mechanische Kreislaufunterstützung auch inflammatorische Folgen habe, die sich negativ auf die Prognose auswirken könnten. Dafür sprächen unter anderem die Ergebnisse der CULPRIT-SHOCK-Studie, in der es vorteilhaft war, wenn im kardiogenen Schock zunächst nur zurückhaltend die Kernläsion kardiologisch therapiert wurde, und nicht alle Läsionen auf einmal.
Weitere Studien stehen an
Einen etwas anderen Blickwinkel auf die Studie warf Prof. Alaide Chieffo, interventionelle Kardiologin vom San Raffaele Krankenhaus in Mailand. Sie wies darauf hin, dass die Zeiten bis zur VA-ECMO teils ungünstig lang gewesen seien und 8 % der Patienten in der ECMO-Gruppe vor Implantation gestorben waren. Gleichzeitig hätten 12,5 % der Patienten in der Kontrollgruppe letztlich doch eine VA-ECMO erhalten hatten, und insgesamt jeder vierte irgendeine Art von mechanischer Kreislaufunterstützung.
Auch sei in der Gruppe mit VA-ECMO – die die kardiale Nachlast erhöht – nur bei 5,8 % der Patienten eine linksventrikuläre Entlastung erfolgt, obwohl das Studienprotokoll das erlaubt hatte. Diese Entlastung erfolgt üblicherweise mit einer zusätzlichen Impella-Pumpe. Thiele betonte, dass die ECLS-SHOCK-Studie zum Thema Impella keine Daten liefere. Hier müsse auf weitere randomisierte Studien gewartet werden, darunter die DanGer-Studie, die Impella mit konventioneller Versorgung vergleicht.
Fazit
Die ECLS-SHOCK-Studie findet bei Patienten mit kardiogenem Schock im Zusammenhang mit einem Myokardinfarkt keinen Nutzen der VA-ECMO.
Eine Metaanalyse, die drei weitere, kleinere Studien einschließt, bestätigt das und kann keine Subgruppe identifizieren, die vielleicht profitieren würde.
Unklar ist, welche Rolle das Timing der ECMO und die zusätzliche linksventrikuläre Entlastung spielen.
Quelle-- ESC-Kongress, Hot-Line-Session 3, 25. bis 28. August in Amsterdam
Literatur-- Thiele H et al. N Engl J Med. 2023; https://doi.org/10.1056/NEJMoa2307227;
Zeymer U et al. Lancet. 2023; https://doi.org/10.1016/So140-6736(23)01607-0

