„Wir sprechen über Ärztemangel und lassen die Menschen warten“
Syrische Ärzte in Deutschland-- Samer Matar und Dr. Amr Abdin sind aus Syrien nach Deutschland gekommen, um hier als Kardiologen zu arbeiten. Im Interview berichten sie, wie kompliziert der Berufseinstieg für ausländische Ärzte in Deutschland ist. Eine neu gegründete Gesellschaft soll unterstützen und Hürden senken.
Veröffentlicht: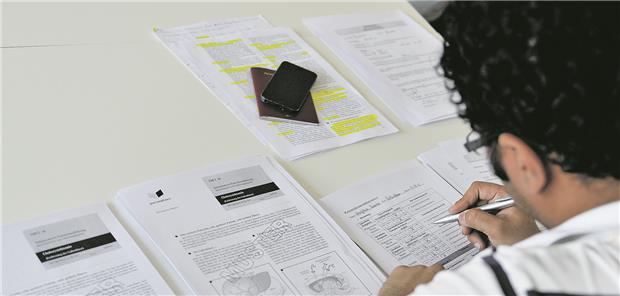
Ärzte und Ärztinnen aus Syrien müssen zunächst eine Kenntnisprüfung ablegen, ehe sie in Deutschland ihren Beruf ausüben können.
© Marc Tirl/picture alliance/dpa (Symbolbild mit Fotomodell)
Herr Matar, Herr Abdin, Sie sind beide aus Syrien nach Deutschland gekommen und arbeiten hier als Ärzte. Wie erging es Ihnen am Anfang in Deutschland?
Amr Abdin: Ich bin Ende 2013 nach Deutschland gekommen. Medizin studiert habe ich in der Kalamoon Universität in Syrien und habe in Damaskus schon zwei Jahre als Assistenzarzt in der Inneren Medizin gearbeitet. Der Start in Deutschland war schwierig für mich. Zum einen die Sprache, zum anderen das System. Ich musste zunächst eine Sprachprüfung und dann eine Kenntnisprüfung ablegen, um überhaupt als Arzt hier arbeiten zu können. Damals war das sogar einfacher als heute. Bei mir dauerte es ein halbes Jahr, bis ich meine erste Stelle in einem Krankenhaus in Bayreuth antreten konnte. Dort war alles neu für mich: Arztbriefe schreiben, mit dem Hausarzt sprechen, die Abwicklung mit den Krankenkassen. Das musste ich erst mal alles verstehen.
Ich bin dann von Bayreuth an die Uniklinik Lübeck gewechselt. Mein Ziel war es immer, in einer Uniklinik zu arbeiten und Forschung zu betreiben. In Lübeck habe ich meine Facharztprüfung zum Kardiologen abgelegt und promoviert. Danach bin ich an die Uniklinik Aachen und jetzt bin ich als Oberarzt am Universitätsklinikum des Saarlandes in Homburg tätig, wo ich auch forsche. Ich habe also Glück gehabt, mein Weg war nicht ganz so schwierig. Ich kenne aber viele syrische Ärzte, die mehr Schwierigkeiten hatten, bei denen es zwei bis drei Jahre gedauert hat, bis sie ihre Approbation erhalten haben. Bei manchen dauerte der Facharzt ewig: sechs, acht, neun Jahre. Viele meiner Kollegen haben zunächst eine Stelle in einem kleineren Krankenhaus gefunden und sind dann an ein größeres Haus gewechselt. Ich weiß nicht, wie es bei Dir war, Samer…
Samer Matar: Ich bin Ende 2014 nach Deutschland gekommen, mit einem auf sechs Monate begrenzten Arbeitssuche-Visum. Innerhalb dieses halben Jahres musste ich Deutsch lernen, meine Papiere anerkennen lassen und einen Job finden, sonst hätte ich wieder gehen müssen. Deshalb habe ich schon in Syrien begonnen, in einem privaten Institut Deutsch zu lernen, bis zum B1-Niveau. In Deutschland bin ich dann zunächst nach Leipzig und habe dort Deutschkurse bis zum C1-Level absolviert. Parallel habe ich meine Unterlagen zur Überprüfung eingereicht. Ich hatte Glück, dass meine Approbation nach sechs Monaten als gleichwertig anerkannt wurde. Diese Nachricht erhielt ich an dem Tag, an dem mein Visum ablief. Ich stand also ganz schön unter Druck. Irgendwie ist es gelungen, das Visum für zwei Monate zu verlängern. Sonst hätte ich einen Asylantrag stellen müssen. Während dieser zwei Monate habe ich mich überall beworben und habe dann meine erste Stelle in Niedersachsen an einer mittelgroßen Klinik bekommen.

Dr. med. Amr Abdin ist Oberarzt am Universitätsklinikum des Saarlandes in Homburg/ Saar, er hat in Syrien Medizin studiert und ist 2013 nach Deutschland gekommen.
© Abdin

Samer Matar ist Facharzt am Herzzentrum Leipzig, er hat in Damaskus Medizin studiert, 2014 ist er nach Deutschland gekommen.
© Matar
Ausländischen Ärztinnen und Ärzten, die in Deutschland arbeiten möchten, wird es also am Anfang nicht gerade leicht gemacht. Was sind die größten Hürden?
Matar: Die größten Hürden sind die Sprachbarriere und die Komplexität des Alltags, also die Dinge, die man im alltäglichen Leben benötigt wie Krankenversicherung, Rentenversicherung usw. Und ein großes Problem ist die Bürokratie. In jedem Bundesland gelten andere Regeln und die Bedingungen ändern sich ständig. Mancherorts muss man sich die Unterlagen von der Botschaft beglaubigen lassen, in Damaskus ist die Botschaft aber geschlossen. Dann muss man auf die umliegenden Länder ausweichen. Dort dauert es aber bis zu sechs Monate, bis man einen Termin zur Beglaubigung bekommt. Es gibt überall Wartezeiten: bis zur Beglaubigung, bis zur Begutachtung, bis zur Prüfung. Wenn man Pech hat, dauert jede dieser Stufen sechs Monate.
Dazu kommen finanzielle Hürden. Ich musste in den ersten sechs Monaten 10.000 Euro für Deutschkurse, Miete, Bewerbung usw. ausgeben. Solche Summen sind für Menschen, die in einem Land, wo Krieg herrscht, nicht selbstverständlich aufzubringen. Zudem ist der Geldtransfer von Syrien nach Deutschland schwierig. Sprich, man muss sich ggf. Geld leihen von Verwandten oder Freunden, die in anderen Ländern leben.
Abdin: Bis man die Regeln alle versteht, vergehen Jahre.
Die Wartezeiten sind also zum Teil beträchtlich, und das, obwohl in Deutschland Ärzte dringend gebraucht werden…
Matar: Ja, das ist paradox, wir sprechen über Ärztemangel und lassen die Menschen sechs Monate auf die Prüfungen warten. Das war auch ein Anstoß für uns, die syrische Gesellschaft für Ärzte und Apotheker in Deutschland, SyGAAD, zu gründen, um das Problem zu beleuchten und präsenter zu machen.
Gemeinsam mit Ihren Kolleginnen und Kollegen haben Sie also eine syrische Gesellschaft für Ärzte und Apotheker in Deutschland (SyGAAD) gegründet. Wie kam es dazu?
Matar: Im Jahr 2009 organisierten sich Kolleginnen und Kollegen aus Syrien in einer Facebook-Gruppe, um sich über den Weg zur Anerkennung des Medizinstudiums in Deutschland auszutauschen. Aus den paar Dutzenden Mitgliedern zu Beginn wurden innerhalb von zwei bis drei Jahren ein paar Hunderte. Inzwischen sind wir 64.000 Mitglieder. Die Angelegenheiten sind im Rahmen einer solchen Gruppe nicht mehr handzuhaben. Deshalb haben wir beschlossen, uns in einer Körperschaft zu organisieren, in Form eines Vereins.
Zur Info: Aktuell arbeiten laut Statistik der Bundesärztekammer 5.400 syrische Ärztinnen und Ärzte in Deutschland. Damit stellen syrische Mediziner die größte Gruppe unter den in Deutschland berufstätigen ausländischen Ärzten dar. Kolleginnen und Kollegen, die inzwischen einen deutschen Pass haben – was nach sechs bis acht Jahren möglich ist – sind in dieser Statistik gar nicht aufgeführt.
Welche Ziele verfolgt die SyGAAD?
Matar: Wir haben drei Ziele: Vernetzung untereinander, Vernetzung mit Kolleginnen und Kollegen des deutschen Gesundheitssystems und gegenseitige Unterstützung sowie Erfahrungsaustausch. Beispielsweise bieten Kolleginnen und Kollegen über dieses Netzwerk Unterkünfte, Hospitationen und sogar finanzielle Unterstützung an. Wir helfen bei Bewerbungen, korrigieren Lebensläufe und unterstützen die sprachliche Entwicklung. Wir beraten und versuchen darüber hinaus, Kanäle mit den Behörden zu öffnen, um die Bürokratie zu vereinfachen. Ziel ist es, den Berufseinstieg für syrische Ärzte und Apotheker in Deutschland zu erleichtern und zu verkürzen. Wir entwickeln derzeit auch ein Mentorenprogramm. In Zukunft würden wir auch gerne Stipendien anbieten. Denn um in Deutschland ein Arbeitsvisum zu bekommen, muss man mind. 12.000 Euro auf einem Sperrkonto vorweisen können.
Darüber hinaus möchten wir die fachliche Situation der Kolleginnen und Kollegen verbessern. Beispielsweise bieten wir kostenlos Vorträge zu Grundlagenwissen an, bilingual und in vereinfachter Sprache, damit jemand, der noch nicht so lange in Deutschland lebt oder noch in Syrien wohnt, das auch versteht. Das unterscheidet uns ein wenig von den anderen Fachgesellschaften, die in Regel eher fachspezifische, fortgeschrittene Lehrinhalte vermitteln. Wir haben innerhalb von 2 Jahren 44 wissenschaftliche Vorträge gehalten.
Wie steht es Ihrer Ansicht nach um die Integration in Deutschland, wurden Sie von Ihren Kolleginnen und Kollegen gut aufgenommen?
Abdin: Ich persönlich habe viele gute Menschen in Deutschland kennengelernt, die mir geholfen haben: Mein Chef, die Kollegen, die Pflege – alle waren sehr nett zu mir. Ich habe mich immer wohlgefühlt. Wenn Sie mich fragen, ob die Türen für ausländische Ärzte offen sind, würde ich antworten: Ja, man kann hier etwas erreichen. Ich bin beispielsweise von 2017 bis 2019 zum Nukleusmitglied der Young DGK gewählt worden, da war ich gerade mal vier Jahre in Deutschland. Das war eine große Ehre für mich. Ich habe eine Oberarztstelle an einer Uniklinik bekommen. Ich halte viele Vorträge, national wie international, ich gehe auf Kongresse, ich mache meine Habilitation. Ich würde sagen, diese Gesellschaft ist offen für uns, das stimmt einfach. Doch obwohl ich selbst gute Erfahrungen gemacht habe, ist das nicht unbedingt die Regel. Ich kenne viele Geschichten von Kollegen, die weniger Glück hatten, mit denen Patienten beispielsweise nicht sprechen wollten, weil sie als Ausländer einen Akzent haben. Letztlich haben aber alle syrischen Ärzte aus meinem direkten Umfeld etwas erreicht hier in Deutschland. Einige sind inzwischen Chefärzte oder leitende Oberärzte oder haben eine Praxis. Wenn man sich gut integriert, hat man die Möglichkeit, weiter zu kommen.
Stimmen Sie dem zu, Herr Matar?
Matar: Auf jeden Fall, ich wurde gut aufgenommen. Meine Chefs und das Team haben mich unterstützt, z. B. bei der Wohnungssuche. Wenn es Anlässe wie die Weihnachtsfeier gab, sind wir alle zusammen hingegangen. Integration ist eine beidseitige Straße. Von der aufnehmenden Seite ist Toleranz, Akzeptanz und Geduld gefordert, von der kommenden Seite Offenheit, Lernfähigkeit und Flexibilität. Man muss seinen Blick öffnen und erweitern. Man kann seine Vorstellung von der Welt nicht eins zu eins in die neue Heimat übertragen.
Abdin: Ich glaube, die Deutschen brauchen länger, bis sie andere Menschen akzeptieren, aber wenn sie so weit sind, dann funktioniert es gut.
Was müsste sich Ihrer Ansicht nach – mit Blick auf die Integration ausländischer Ärztinnen und Ärzte in das deutsche Gesundheitswesen – noch verbessern?
Matar: Die langen Wartezeiten sollten verkürzt werden. Vielleicht wäre es auch sinnvoll, den Zugang zu Sprachkursen zu erleichtern. Während der Hospitation und Einarbeitung sollten Kurse zur Verbesserung der deutschen Sprache und am besten auch der Fachsprache angeboten werden, das wäre eine Erleichterung für alle. Denn die Sprache ist das A und O. Ein Stipendienangebot zur finanziellen Unterstützung von Kollegen, die noch im Ausland leben und nach Deutschland kommen möchten, wäre ebenfalls eine gute Sache. Aber das Wichtigste ist, die bürokratischen Hürden zu senken – also einheitliche klare Regeln.
Abdin: Generell ist es wichtig, Geduld zu haben. Ausländische Ärztinnen und Ärzte brauchen mehr Zeit, bis sie alles verstehen und auch um die Gesellschaft, die Kultur zu verstehen. Als Ausländer in Deutschland zu arbeiten, ist nicht so einfach.
Sie haben ja schon in Syrien als Ärzte gearbeitet. Wie unterscheidet sich Ihre heutige Arbeit von der damals?
Abdin: Ich habe in Damaskus in einem großen Krankenhaus gearbeitet. Pro Schicht kamen circa 80 Patientinnen und Patienten in die Notaufnahme. Es gab dort aber kein Notfallherzkatheterlabor. Sprich, bei Patienten mit einem Herzinfarkt haben wir immer eine Lyse gemacht. Insgesamt habe ich in meinem Leben sicher mehr als 30 bis 40 Mal eine Lyse gemacht. Nur wer Geld hat, kann in Syrien in einer Privatklinik eine Katheteruntersuchung erhalten. 80 Prozent der Menschen dort haben aber nicht genügend Geld dafür. Laut einer Umfrage können sich 60 Prozent der Menschen noch nicht mal die medikamentöse Herzinsuffizienztherapie leisten. Ich habe das meinem Chef in Deutschland erzählt und der war geschockt. Es mangelt auch an Technik. Ein Echo wird beispielsweise nicht regelmäßig gemacht. Eine Rhythmologie gibt es gar nicht in Syrien, d. h. es werden überhaupt keine Ablationen, keine CRT gemacht. Durch den Krieg hat sich die Situation noch verschlimmert.
Deshalb ist es mir auch wichtig, Ärzte in Syrien zu unterstützen. Es ist gut, dass wir die SyGAAD gegründet haben, um syrischen Ärzten in Deutschland zu helfen. Auf der anderen Seite gibt es Ärzte in Syrien, die nicht die Möglichkeit oder das Glück hatten, nach Deutschland zu kommen. Seit vielen Jahren versuche ich deshalb, regelmäßig dort hinzureisen, um Fortbildungen und Workshops anzubieten. Ich habe z. B. Schrittmacherkurse und Fortbildungen zur Herzinsuffizienztherapie durchgeführt, den Ärzten gezeigt, wie man abladiert usw. Das hat mir ein sehr gutes Gefühl gegeben. Die Menschen dort haben Lust, etwas zu lernen, aber sie haben die Möglichkeiten nicht, es gibt nicht immer Strom, nicht immer Internet.
Trotz dieser Bedingungen haben wir viel erreicht in den letzten Jahren. Es gibt inzwischen sogar Forschung in Syrien. Aktuell sind drei Paper im Review, die Daten stammen ausschließlich aus Syrien. Eines davon ist bald online, hoffe ich. Seit zehn Jahren wurde keine wissenschaftliche Arbeit mehr aus Syrien publiziert. Und jetzt kommt ein Paper in Kriegszeiten mit syrischen Autoren, sechs davon arbeiten in Syrien, drei in Deutschland. Das ist ein Traum. Wenn man davon jemandem erzählt, glaubt das keiner. Deshalb lautet meine Botschaft: Wir sollten alle Ärztinnen und Ärzte unterstützen, egal ob sie hier in Deutschland arbeiten oder in Syrien leben.
Matar: In Syrien fehlt es nicht an Wissen, sondern an Ressourcen. Es gibt dort nicht genug Material für alle kranken Menschen. Die Ärzte lernen deshalb, zu improvisieren und zu triagieren, d. h. man muss sich überlegen, wie man das verfügbare Material leitliniengerecht einsetzen kann.
Prinzipiell läuft die medizinische Weiterbildung in Syrien strukturierter ab als in Deutschland, solange das Material vorhanden ist. In Syrien dauert der Facharzt zum Kardiologen fünf bis sechs Jahre. Es gibt einen Plan für jedes Jahr, der festschreibt, was in dieser Zeit zu lernen ist. In Deutschland kann der Facharzt auch zwölf Jahre dauern, hier gibt es keine festgeschriebenen Lernpläne.
Außerdem verbringen Ärzte in Syrien deutlich weniger Zeit mit der Dokumentation oder rechtlichen Fragen. Man konzentriert sich mehr darauf, wie man dem Patienten helfen kann, ohne ihn finanziell zu belasten.
Zum Schluss noch eine persönliche Frage: Wie stellen Sie sich Ihre Zukunft vor, möchten Sie in Deutschland bleiben?
Matar: Ich habe vor Kurzen meine Weiterbildung als Internist beendet und bin jetzt ins Herzzentrum Leipzig gewechselt. Dort möchte ich meine akademische Karriere aufbauen und meine Weiterbildung als Kardiologe zu Ende bringen: also promovieren, forschen und fortbilden. Als Forschungsthema interessieren mich künstliche Intelligenz und die Rolle der Telemedizin.
Ein Traum von mir ist es, Teil einer digitalisierten Medizin zu werden und entsprechende Konzepte mit zu entwickeln. Ich glaube nämlich, dass die Digitalisierung dazu beitragen kann, ärmeren Ländern einen besseren Zugang zur medizinischen Versorgung zu verschaffen. In Syrien etwa sind die großen Städte sehr gut versorgt mit Medizinern, Krankenhäusern und Technik, auf dem Land ist eine solche Versorgung nicht gegeben. Durch digitalisierte Konzepte könnte der Zugang für die Landbevölkerung erleichtert werden: Follow-up-Termine könnten online durchgeführt werden, Medikamente und notwendiges Material könnten per Post verschickt werden.
Abdin: Ich bleibe auch in Deutschland. Deutschland ist meine zweite Heimat geworden, auch wenn ich Heimweh nach Syrien habe. Ich lebe hier seit acht Jahren, habe Familie hier und Kinder bekommen. Deshalb geht es nicht nur darum, was ich möchte, sondern auch darum, was meine Familie will. Und ich denke, wir bleiben in Deutschland. Wie es nach der Habilitation weitergeht, weiß ich noch nicht so recht, mal schauen. Mein Wunsch wäre, in regelmäßigen Abständen nach Syrien zu gehen, um dort den Menschen zu helfen. Meine Zeit zu 70 Prozent in Deutschland und zu 30 Prozent in Syrien zu verbringen – das wäre mein Traum.
Herr Matar, Herr Abdin, vielen Dank für das Gespräch!
Info SyGAAD
Die syrische Gesellschaft für Ärzte und Apotheker in Deutschland ist eine neu gegründete Gesellschaft syrischer Akademiker im medizinischen Bereich in Deutschland.
SyGAAD öffnet die Tür zur Mitgliedschaft für alle syrischen Akademiker, die in Deutschland im medizinischen Bereich tätig sind.
Sie begrüßt auch den Beitritt von Studenten und Kollegen, die sich noch auf dem Weg zur ersten Tätigkeit in Deutschland befinden.
Weitere Informationen finden Sie unter www.sygaad.de/home/de

